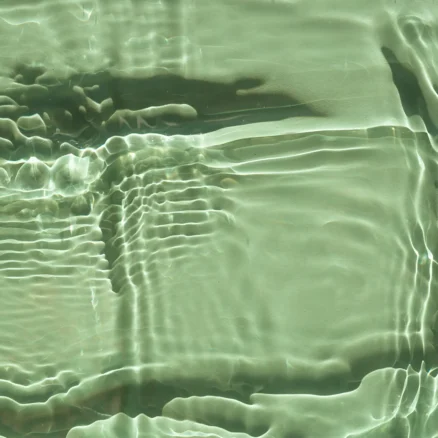Angesichts der schier unüberschaubaren Zahl von Inhaltsstoffen in den Formulierungen moderner Schönheitsprodukte und der Bedeutung der Verpackung als Gesicht des Produkts müssen die F&E- und Produktdesignteams wichtige Entscheidungen über die zu verwendenden Rohstoffe treffen.
Angesichts der schier unüberschaubaren Zahl von Inhaltsstoffen in den Formulierungen moderner Schönheitsprodukte und der Bedeutung der Verpackung als Gesicht des Produkts müssen die Teams für Forschung und Entwicklung und die Produktdesignteams wichtige Entscheidungen über die zu verwendenden Rohstoffe treffen.Verbraucherinnen und Verbraucher achten heute bewusster auf die Inhaltsstoffe, was F&E-Teams dazu veranlasst, nachhaltigen Bestandteilen den Vorzug zu geben. Und das ist nicht alles: Die Regularien zur Produktnachhaltigkeit werden strenger, Investorinnen und Investoren beurteilen ein Unternehmen nicht mehr nur nach Geschäftszahlen und Einzelhändler wie Sephora führen ihre eigenen Nachhaltigkeitsrichtlinien für Marken ein.
Deshalb suchen viele Kosmetik- und Körperpflegemarken nach innovativen Lösungen.Dabei konzentrieren sie sich aber oft nur auf die üblichen Verdächtigen: angesagte Verbrauchertrends wie natürliche Schönheit oder die Einhaltung von Selbstverpflichtungen zur Reduzierung der CO2– oder Kunststoffemissionen. Das birgt die Gefahr einer unbeabsichtigten Wirkungsverschiebung.
Wirkungsverschiebung: eine große Herausforderung für die Kosmetikindustrie
Kosmetikmarken wenden sich immer mehr Rohstoffen aus natürlichen Quellen zu, sodass die Risiken einer Wirkungsverschiebung für sie besonders relevant sind. Verbraucherinnen und Verbraucher sehen natürliche Inhaltsstoffe als chemisch weniger schädlich oder als nachhaltiger an, was die Nachfrage nach biologischen Rohstoffen steigen lässt. Andere bekannte Nachhaltigkeitsprioritäten, wie die Dekarbonisierung und die Verringerung der Kunststoffverschmutzung, verstärken ebenfalls den Trend zu natürlichen Rohstoffen, was für Inhaltsstoffe und Verpackungsmaterialien gleichermaßen gilt. Das zeigt sich zum Beispiel an der wachsenden Beliebtheit pflanzlicher ätherischer Öle, der Nachfrage nach Bioethanol aus Zuckerrohr, der Ersetzung CO2-intensiver Silikone durch biobasierte Ester, der Verdrängung von Kunststoff durch Fasermaterialien bei Verpackungen und der Einführung von Zellulose als Ersatz für Mikroplastik.
Bio-Materialien können jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Landnutzung und die biologische Vielfalt haben. Eines der bekanntesten Negativbeispiele ist der Anbau von Palmöl, der zwischen 2000 und 2018 für7 % der globalen Entwaldung verantwortlich zeichnete. Bei einigen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel ätherischen Ölen, hat die steigende Nachfrage außerdem zu einer industrialisierten Produktion geführt. Ätherische Öle benötigen große Rohstoffmengen bei geringer Ausbeute. Ein Beispiel: Für einen einzigen Tropfen Rosenöl braucht man 50 Rosenblätter. Die Industrialisierung der Produktion kann zu einem verstärkten Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden führen, um die Nachfrage zu befriedigen. So führen diese Rohstoffverlagerungen zu ungewollten Wirkungsverschiebungen von einem natürlichen System zum anderen: Wir erzeugen weniger CO2, aber verbrauchen dafür mehr Wasser; wir reduzieren die Kunststoffverschmutzung, aber vernichten dafür unsere Wälder.
Nachhaltige Transformation mag mit den besten Absichten einhergehen – trotzdem kommt es immer wieder zu solchen Zielkonflikten. Die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie muss sich der Risiken bewusst sein und fundierte Entscheidungen treffen.
Wirkungsverschiebungen zu vermeiden, erfordert den Übergang von einem reinen Innovationsmodell mit wenigen ausgewählten Zielen zu einem ganzheitlicheren Ökodesign für nachhaltige Produktinnovationen, das die Auswirkungen auf die Umwelt insgesamt begrenzt. Unternehmen, die Wirkungsverschiebungsrisiken erkennen und abfedern, gestalten ihre Rohstoffauswahl zukunftssicher und reduzieren ihre Umweltauswirkungen effizienter. Für diesen Wandel sind drei Schritte wichtig:
1. Verstehen der ganzheitlichen Auswirkungen von Rohstoffen und Erkennen von Wirkungsverschiebungsrisiken
Kluge Rohstoffinnovationen erfordern zunächst eine Lebenszyklusanalyse (LCA), um die vielschichtigen Auswirkungen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts zu bewerten. Eine Ressource ist die europaweite Product Environmental Footprint (PEF)-Methodik, die 16 Indikatoren zur Messung der Auswirkungen auf den Klimawandel, die Ökosysteme, die menschliche Gesundheit, die Ressourcennutzung und den Wasserverbrauch enthält. Gemeinsam mit Quantis entwickelte L’Oréal das Sustainable Product Optimization Tool (SPOT), ein Ökodesign-Tool zur laufenden Bewertung der Umweltbilanz der Marke.
2. F&E-Teams müssen Wirkungsdaten nutzen können
Die Messung von Auswirkungen allein reicht für nachhaltige Innovationen nicht aus. Unternehmensteams müssen Wirkungsdaten nutzen können, um Produktentscheidungen zu treffen, zum Beispiel durch:
Neugestaltung von Produktentwicklungsprozessen, sodass Informationen über Umweltauswirkungen schon in den ersten Planungsphasen einbezogen werden können. Verfügbare Wirkungsdaten existieren oft isoliert in speziellen Nachhaltigkeitsteams, während F&E-Teams außen vor bleiben. Umwelterwägungen fließen, wenn überhaupt, erst spät in den Produktentwicklungsprozess ein.
Einbeziehung von Umwelterwägungen in die Governance-Strukturen – neben anderen geschäftlichen Erwägungen wie Rentabilität und Effizienz. Klare Regeln und Strukturen können die Entscheidungsfindung in wichtigen Entwicklungsphasen rationalisieren. Zum Beispiel nimmt eine Marke nur Produkte ins Programm auf, die insgesamt weniger Auswirkungen als ihre Vorgänger haben oder die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Schulung von F&E- und anderen Teams zu Produktnachhaltigkeit und LCAs, damit sie Daten verstehen, eine Ökodesignkultur entwickeln und Zielkonflikte optimal lösen können.
3. Kooperation mit der Wertschöpfungskette
Die Beschaffungsteams spielen eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der nachhaltigsten Rohstoffe, um Wirkungsverschiebungsrisiken zu mindern. Das erfordert jedoch einen internen Dialog zwischen Beschaffungs-, F&E- und Nachhaltigkeitsteams, um die Ziele zu koordinieren. Eine Wirkungsverschiebung in der Wertschöpfungskette kann zum Beispiel mittels folgender Hebel abgemildert werden:
Bewährte Praktiken bei der nachhaltigen Beschaffung risikoreicher Rohstoffe, zum Beispiel die Frage nach anerkannten Zertifizierungen wie Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) oder Forest Stewardship Council (FSC), die Überwachung von Lieferanten oder die gemeinsame Ausarbeitung nachhaltiger Beschaffungsstrategien. Außerdem kann eine gute Zusammenarbeit mit Lieferanten die Versorgung mit vorübergehend begrenzt verfügbaren nachhaltigen Rohstoffen sichern.
Anwendung und Unterstützung einer agrarökologischen Praxis, wie zum Beispiel regenerativer Landwirtschaft, innerhalb der Wertschöpfungskette. Durch die umfassende Realisierung dieser Maßnahmen können Unternehmen nicht nur Auswirkungen reduzieren, sondern auch proaktiv eine naturschonende Arbeitskultur entwickeln.
Unterstützung kontinuierlicher Rohstoffinnovationen durch Zusammenarbeit mit Lieferanten (einschließlich Start-ups) mit dem Ziel, geprüfte Alternativen zu natürlichen Rohstoffen, wie zum Beispiel Algen oder landwirtschaftliche Abfälle, zu entwickeln. Einige Parfümmarken haben mit Ethanol aus der Kohlenstoffabscheidung experimentiert. Dieser Ansatz reduziert die Landnutzung und kommt fast ohne Wasser aus, während Firmen, die Silikone ersetzen wollen, über biologische Ester aus Abfällen nachdenken.
Ganzheitlichkeit und Innovation
Staatliche Regularien, Berichterstattungsstandards und der öffentliche Diskurs greifen den Trend eines umfassenderen Nachhaltigkeitsverständnisses auf. Laut einer Studie der Boston Consulting Group beklagten 71 % der Käuferinnen und Käufer von Hautpflegeprodukten, dass Nachhaltigkeit nicht genügend berücksichtigt werde. In Europa und den USA befassen sich aktuelle und zukünftige Rechtsvorschriften für Kosmetikprodukte mit Themen wie Entwaldung, Verringerung der Kunststoffverschmutzung und Regulierung von als umweltschädlich geltenden Inhaltsstoffen. Gleichzeitig erweitert die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) die Anforderungen nicht nur hinsichtlich des Klimawandels, sondern auch der Offenlegung der Auswirkungen und Abhängigkeiten der Unternehmen auf die bzw. von der Natur. Gleichzeitig erweitert die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) die Anforderungen nicht nur hinsichtlich des Klimawandels, sondern auch der Offenlegung der Auswirkungen und Abhängigkeiten der Unternehmen auf die bzw. von der Natur.
Um Produkte und Geschäftsmodelle zukunftssicher zu machen und eine Wirkungsverschiebung zu vermeiden, müssen Kosmetikmarken bei der Entwicklung ihrer Produkte eine ganzheitliche Sicht einnehmen und Umweltauswirkungen in ihrer ganzen Vielschichtigkeit berücksichtigen. Nur so wird es den F&E-Teams gelingen, nachhaltigere Kosmetika zu entwickeln und die Branche auf einen zeitgemäßen Weg zu führen.