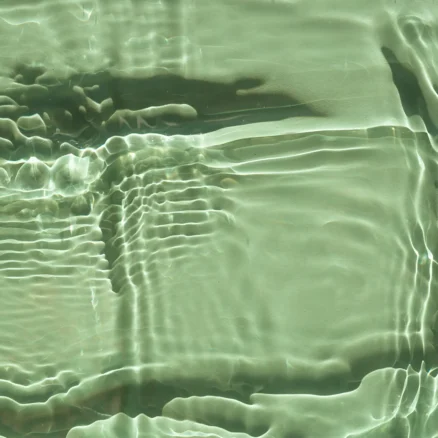2050: Das ist die Frist, die uns Wissenschaftler gesetzt haben, um die weltweiten CO2-Emissionen auf Null zu reduzieren, wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 °C begrenzen und die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt abmildern wollen. Das wachsende öffentliche Bewusstsein für die Notwendigkeit, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, hat einen Feuersturm von Unternehmensverpflichtungen ausgelöst. Allein im letzten Jahr hat sich die Zahl der Unternehmen, die sich verpflichtet haben, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, verdreifacht– von 500 Ende 2019 auf 1.541.
Da das Netto-Null-Ziel nun als neuer Standard für Klimaschutzmaßnahmen gilt, stehen die Unternehmen mehr denn je unter Druck, ihre Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken. Um diesen Ehrgeiz in Maßnahmen umzusetzen, die uns auf dem Weg zur Erreichung von Netto-Null bis 2050 halten, brauchen wir eine gemeinsame, wissenschaftlich fundierte Definition dessen, was dieses Ziel für Unternehmen bedeutet und wie sie es erreichen können. Das bedeutet, dass wir die Wissenschaft hinter der CO2-Reduzierung und demCO2-Abbau verstehen müssen.
Netto-Null als Nordstern: aber wohin gehen wir?
Die rasche Zunahme der Netto-Null-Ziele von Unternehmen ist ein willkommener Anblick, da wir uns dem Ende des ersten Jahres in dem vom Internationalen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) als Jahrzehnt des Handelns bezeichneten Zeitraum nähern. Sobald wir jedoch beginnen, unter der Oberfläche zu kratzen und einen genaueren Blick darauf zu werfen, was die Ziele und Forderungen tatsächlich für das Handeln bedeuten, treten einige ernsthafte Diskrepanzen zutage – das Niveau der Ambitionen und der Klimaauswirkungen variiert erheblich. Da es keinen allgemeinen Konsens darüber gibt, was “Netto-Null” für die Industrie bedeutet, müssen die Unternehmen das Ziel selbst interpretieren, wobei die Marktkräfte im Spiel sind. Infolgedessen wird das Ziel auf sehr unterschiedliche Weise interpretiert – einige davon könnten dazu führen, dass wir auf unserem Weg zur Transformation an Fahrt verlieren und es unmöglich machen, Netto-Null rechtzeitig zu erreichen.
Unternehmen, die sich wirklich für dieses Ziel engagieren, entwickeln Ziele und investieren in Strategien, die es ihnen ermöglichen, ihren potenziellen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel zu maximieren. Dazu gehören erhebliche Emissionssenkungen in der gesamten Wertschöpfungskette und die Umstellung der Geschäftsmodelle auf eine Netto-Null-Wirtschaft. Dieser Ansatz erfordert eine tiefgreifende Abkehr vom “Business as usual”.
Über die Reduktionen hinaus ist es eine gängige Strategie, die CO2-Entfernung zu nutzen – zum Beispiel durch das Pflanzen von Bäumen -, um die Netto-Null-Schwelle zu erreichen. Dies ist für den langfristigen Unternehmenserfolg und für das Klima nicht unproblematisch. Obwohl der Abbau von Treibhausgasen ein wichtiger Bestandteil einer wirksamen globalen Netto-Null-Strategie ist, werden wir damit allein nicht die 1,5°C-Marke erreichen.
Warum also sind Umzüge so stark im Kommen? Viele Unternehmen wollen als Teil der Lösung wahrgenommen werden, als Schöpfer von Vorteilen und nicht als Verursacher von Belastungen. Je höher der Abbau ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir unsere Geschäfte und unsere Gesellschaft wie gewohnt weiterführen können. Und wer kann schon etwas dagegen haben, Bäume zu pflanzen und einen gesunden Boden zu fördern? Viele Unternehmen und Verbraucher verstehen jedoch nicht die Wissenschaft, die hinter der Bilanzierung potenziell reversibler Entnahmen steht.
Wenn Unternehmen die Behauptung aufstellen, dass sie oder ihre Produkte Netto-Null-Emissionen aufweisen, während sie weiterhin wie gewohnt fossile CO2-Emissionen ausstoßen, vermittelt dies der Öffentlichkeit die falsche Botschaft, dass sie zur globalen Kohlenstoffneutralität im Sinne der vom IPCC dargelegten Wissenschaft beitragen. Der Kohlenstoffabbau kann als “Königsweg” angesehen werden, als einfache Lösung für ein komplexes Problem. Eine zu starke Vereinfachung und Entkontextualisierung der ihnen zugrunde liegenden Klimawissenschaft, gepaart mit einem Mangel an wissenschaftlicher Kontrolle, verstärkt diese Vorstellung noch. Dies kann zu ineffektiven Maßnahmen, Greenwashing und unbeabsichtigten Umweltauswirkungen führen.
(Miss-)Verständnis der Wissenschaft von Umzügen
Als marktorientierte Gesellschaft suchen wir instinktiv nach marktbasierten Lösungen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Aber wir müssen mit Vorsicht vorgehen, auf der Grundlage eines soliden Verständnisses der Wissenschaft und einer systemischen Sichtweise.
Die Absicht der Märkte für Kohlenstoffabbau ist letztlich bewundernswert: Sie sollen Unternehmen dazu zwingen, den Beitrag ihrer Tätigkeiten und Lieferketten zum Klimawandel zu berücksichtigen. In der Praxis beruhen sie jedoch häufig auf einem vereinfachten und fehlerhaften Verständnis von Netto-Null, nämlich dass eine TonneCO2, die von Bäumen oder Böden aufgenommen und gespeichert wird, eine Tonne fossilerCO2-Emissionen neutralisiert. Bei dieser Art der Bilanzierung werden zwei unterschiedliche Konzepte der Nachhaltigkeitswissenschaft verwechselt: Bestand und Wirkung.
Bei der Bilanzierung von Treibhausgasen (THG) ist das Inventar der Fluss von Treibhausgasen in und aus einem System. Zum Beispiel kann der Fluss von CO2 aus der Atmosphäre in landwirtschaftliche Böden für ein landwirtschaftliches System inventarisiert werden. Auswirkungen, in diesem Fall Klimaauswirkungen, beziehen sich auf das Potenzial eines Treibhausgasflusses, zu einer globalen Temperaturänderung zu führen. In vielen Fällen wird die Bestandsaufnahme mit den Auswirkungen verwechselt, insbesondere in Bezug auf den Kohlenstoffabbau.
Wenn CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird, handelt es sich um einen Bestandsfluss. Um die Auswirkungen des Abbaus auf das Klima zu bewerten, müssen wir die Zeitspanne berücksichtigen, in der es abgebaut wird. Der internationale Konsens über die Bilanzierung von Treibhausgasen, wie er vom IPCC dargelegt wurde, empfiehlt einen Zeitrahmen von 100 Jahren, um die Auswirkungen eines THG-Bestandsflusses in einem bestimmten Jahr auf das Klima zu berücksichtigen.
Folgt man dem 100-Jahres-Zeithorizont des IPCC für das Erderwärmungspotenzial und wählt einen pragmatischen Modellierungsansatz, so bedeutet dies, dass eine Tonne CO2, die heute in einem Baum gespeichert ist, in den nächsten 100 Jahren gespeichert bleiben muss, um eine Tonne des heute emittierten fossilen CO2 zu neutralisieren. Vereinfacht ausgedrückt, muss der Atmosphäre 100 Jahre lang Kohlenstoff entzogen werden, um als vollständig negative Emission zu gelten. Bei der Bilanzierung des Kohlenstoffs, der der Atmosphäre in einem Jahr oder über mehrere Jahre entzogen wird, um eine Emission zu neutralisieren, wird im Wesentlichen davon ausgegangen, dass diese Speicherung dauerhaft ist. Die biogene Speicherung (in Böden und Bäumen gebundener Kohlenstoff) kann jedoch durch Änderungen in der Landnutzung oder durch Ereignisse wie Brände oder Überschwemmungen rückgängig gemacht werden.
Um die CO2-Bilanz wieder auf das vorindustrielle Niveau zu bringen, müsste theoretisch mehr Kohlenstoff gebunden werden, als durch die anthropogene Zerstörung natürlicher Systeme durch Abholzung und Landnutzungsänderung UND den gesamten fossilen Kohlenstoff freigesetzt wurde. Das ist eine große Aufgabe.
Genau aus diesem Grund hat der IPCC betont, dass eine starkeReduzierung der CO2-Emissionen (41-58 % bis 2030 und 91-95 % bis 2050) sowie eine Verringerung der Emissionen von Methan (CH4) und Distickstoffoxid (N2O) Vorrang haben muss. Dies ist der praktikabelste Weg, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen, und um zu vermeiden, dass wir in Zukunft auf den groß angelegten Einsatz von Kohlendioxidabscheidung angewiesen sind. Das Überschreiten der 1,5°C-Grenze wird zu irreversiblen Schäden an der Lebensmittel- und Wassersicherheit, der Infrastruktur, den Ökosystemen und der menschlichen Gesundheit führen. Aus diesem Grund schlagen einige Organisationenvor, dass Unternehmen keine kohlenstoffneutralen oder Netto-Null-Behauptungen aufstellen dürfen, da sie sich auf einen globalen Zustand der CO2-Bilanz beziehen sollten – nicht auf den Zustand eines einzelnen Unternehmens.
Warum wissenschaftliche Aufsicht wichtig ist: Lehren aus den Biokraftstoffen
Biokraftstoffe sind ein abschreckendes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn eine marktorientierte Lösung die Auswirkungen auf das Klima zu stark vereinfacht und entkontextualisiert und sich auf die Bestandsströme konzentriert.
In den letzten zwei Jahrzehnten wurden Biokraftstoffe (aus Mais, Palmöl, Zuckerrohr und anderen pflanzlichen Rohstoffen) auf einigen Märkten als nachhaltige Alternative zu fossilen Kraftstoffen beworben. Anfänglich wurden sie als vielversprechende Lösung zur Abkehr von fossilen Brennstoffen angesehen. Man ging davon aus, dass Biokraftstoffe die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nicht erhöhen würden, da das bei der Verbrennung von Biokraftstoffen freigesetzte CO2 erst vor kurzem in der Atmosphäre war und erst kürzlich von einer Pflanze durch Photosynthese aufgenommen wurde, im Gegensatz zu fossilen Kraftstoffen, die Kohlenstoff enthalten, der von Pflanzen vor Millionen von Jahren gebunden wurde. Deshalb wird die Freisetzung von CO2 durch Biokraftstoffe in der Regel als klimaneutral angesehen.
Auf molekularer Ebene ist das sinnvoll. Betrachtet man jedoch die Systemebene, so rücken die umfassenderen Auswirkungen von Biokraftstoffen – Landnutzungsänderungen und Entwaldung, die CO2 in die Atmosphäre freisetzen und das Sequestrierungspotenzial verringern – in den Mittelpunkt. Jetzt, im Jahr 2020, hat die Europäische Union einen Rahmen entwickelt, um Biokraftstoffe aus Pflanzen, die ein Risiko für Landnutzungsänderungen darstellen, bis 2030 schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen, nachdem sie im Laufe der Jahre beobachtet hat, wie der Biokraftstoffmarkt zu Landumwandlungen und Entwaldung geführt hat.
Eine ähnliche Situation zeichnet sich mit der raschen Expansion der Kohlenstoffmärkte ab, die sich auf die Vorteile der Kohlenstoffentnahme konzentrieren. Diese weitgehend unregulierten Märkte legen den Schwerpunkt auf Investitionen in die Bindung von Kohlenstoff in Bäumen und Böden. Bislang gibt es keine strengen Regeln, die festlegen, welcher Anteil der Emissionen eines Unternehmens durch Kohlenstoffbindung neutralisiert werden kann. Ist es ein Viertel? Die Hälfte? Ganz? Dürfen Unternehmen überhaupt behaupten, dass sie neutral sind? Der Mangel an Klarheit und die Flexibilität bei der Anwendung des Konzepts durch die Unternehmen führen dazu, dass viele Behauptungen zur Klimaneutralität bedeutungslos sind.
Net Zero richtig machen
Wir können und wir müssen es besser machen. Und so geht’s:
1+ Schaffung eines standardisierten, wissenschaftlich fundierten Verständnisses der Rolle von Ablagerungen im Hinblick auf das Erreichen von Netto-Null für die Industrie.
Eine solide Definition dessen, was Netto-Null für Unternehmen bedeutet und wie sie dieses Ziel erreichen können, ist von entscheidender Bedeutung, wenn Netto-Null-Ziele einen echten Wandel bewirken und ihr Versprechen einlösen sollen.
In jüngster Zeit gab es mehrere Aktivitäten in Richtung dieses Ziels, darunter die Veröffentlichung eines Papiers der Science Based Targets Initiative über die Festlegung von wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen im Unternehmenssektor und die Veröffentlichung des Rahmens für Kohlenstoffneutralität von Carbone 4 und der Net Zero Initiative. Erstere schlägt vor, dass ein Netto-Null-Konzept auf Unternehmen angewandt werden kann, wobei die Reduzierung Priorität hat, während letztere vorschlägt, dass Unternehmen nur auf kollektive, globale Ziele hinarbeiten können, aber keinen Anspruch auf Neutralität oder Netto-Null erheben können.
Die richtigen Rechnungslegungsvorschriften müssen vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die Arbeit für das Ziel der Kohlenstoffneutralität oder der Nettonullstellung dem Gemeinwohl zugute kommt und nicht nur dem öffentlichen Image oder dem Marketing eines Produkts oder Unternehmens dient.
2+ Verbuchung des Kohlenstoffabbaus als Klimawirkung und nicht als Inventar.
Denken Sie daran, dass der Fluss eines Treibhausgases vielleicht für ein bestimmtes Jahr erfasst wird, aber die Auswirkungen auf das Klima sind der Beitrag zum globalen Temperaturanstieg über einen bestimmten Zeithorizont – nach internationalem Konsens 100 Jahre. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass CO2 mindestens 100 Jahre lang aus der Atmosphäre entfernt werden muss, um eine fossile CO2-Emission in einem bestimmten Jahr vollständig zu neutralisieren.
3+ Denken Sie über den Kohlenstoff hinaus und suchen Sie nach Win-Win-Situationen.
Einige Lösungen zur Verringerung und Beseitigung von Kohlenstoff können auch Vorteile für andere planetarische Grenzen bieten. Bäume sind entscheidend für die Förderung der Bestäubung und der Artenvielfalt und verhindern die Bodenerosion. Gesunde Böden fördern auch die biologische Vielfalt, indem sie einen physikalisch und chemisch komplexen Lebensraum für die verschiedenen Organismen bieten, die zur Regulierung der lebenswichtigen Bodenfunktionen beitragen. Darüber hinaus sind gesunde Böden entscheidend für die Aufrechterhaltung von Produktivität und Produktqualität und verringern die Abhängigkeit von übermäßigem Chemikalieneinsatz, der zur Überschreitung der planetarischen Grenzen für Stickstoff- und Phosphorkreisläufe beiträgt.
Quantis ist dabei, Stakeholder zu versammeln und mit unseren Kunden an diesen wichtigen Punkten zu arbeiten, um sicherzustellen, dass sowohl die Reduktionspfade als auch die CO2-Entfernung in einer Weise berücksichtigt werden, die mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmt und den geschäftlichen Wandel fördert. Werden Sie sich uns anschließen?