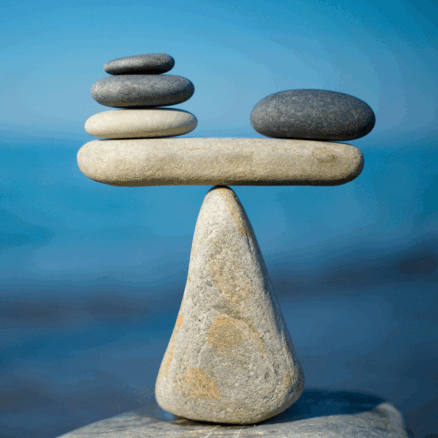In Kürze:
- Der erhebliche ökologische Fußabdruck des Chemiesektors macht ihn zu einem zentralen Akteur der Dekarbonisierung – insbesondere im Bereich der Scope-3-Emissionen.
- Der Einkauf entwickelt sich zu einem strategischen Hebel – mit dem sich Emissionen schneller und kosteneffizient senken lassen, indem gezielt besonders emissionsintensive Lieferanten und Materialien adressiert werden.
- Die Zusammenarbeit mit strategischen Lieferanten zur Emissionsreduktion verbessert nicht nur die Leistung – sie schafft auch das Vertrauen, das für künftige Innovationen und gemeinsame Risikotragung erforderlich ist.
- Die Integration von CO₂-Daten in Beschaffungsentscheidungen hilft Unternehmen, ihre Risiken im Zusammenhang mit strengeren CO₂-Bepreisungssystemen wie dem EU-Emissionshandel (ETS) und dem kommenden CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) besser zu steuern.
- Der Umstieg auf erneuerbare Rohstoffe wie Biomasse, Algen oder Agrarabfälle wird zunehmend wirtschaftlich tragfähig und ist strategisch notwendig.
- Die gemeinsame Betrachtung vorgelagerter Emissionen und naturbezogener Risiken stärkt die Resilienz der Lieferkette, schützt Margen und positioniert Unternehmen langfristig erfolgreich.
Die chemische Industrie ist ein grundlegender Bestandteil der globalen Wirtschaft und beeinflusst nahezu jedes Produkt und jeden Sektor – von der Landwirtschaft und Pharmaindustrie bis hin zu Mobilität, Elektronik und Bauwesen. Doch diese Reichweite hat ihren Preis: einen erheblichen ökologischen Fußabdruck – ein Großteil davon liegt in weit verzweigten, komplexen Lieferketten verborgen.
Über Jahre hinweg wurde Dekarbonisierung im Chemiesektor als kostspielige Notwendigkeit betrachtet – als Kompromiss zwischen ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Tragfähigkeit. Heute wird diese Sichtweise zunehmend infrage gestellt. Immer mehr Chemieunternehmen zeigen, dass Emissionsreduktion nicht nur der Einhaltung von Vorschriften dient, sondern ein strategischer Hebel ist, um Effizienz zu steigern, Risiken zu managen und langfristigen Unternehmenswert zu schaffen. Richtig umgesetzt kann sie zudem die Beschaffungskosten senken, die Versorgungssicherheit erhöhen und die Geschäftstätigkeit gegenüber verschärften Vorschriften zukunftssicher machen.
Von der Einhaltung der Vorschriften zum Wettbewerbsvorteil
Viele Chemieunternehmen haben Fortschritte bei der Dekarbonisierung ihrer direkten Aktivitäten erzielt, doch Scope-3-Emissionen – von vorgelagerten Rohstoffen bis zur Nutzung der Endprodukte – machen weiterhin den Großteil des Klima-Fußabdrucks der Branche aus. Die vorgelagerten Emissionen im Chemiesektor werden vor allem durch fossile Rohstoffe wie Naphtha und Erdgas verursacht – sowie durch Treibhausgasemissionen aus anderen Chemikalien, eingekauften Materialien, Transporten und sonstigen vorgelagerten Lieferantenaktivitäten. Die Reduktion dieser Emissionen erfordert eine direkte Zusammenarbeit mit der Lieferkette – beginnend bei den Lieferanten und Materialien mit dem größten Klimaeinfluss.
Für Chemieunternehmen ist die Dekarbonisierung vorgelagerter Prozesse damit einer der wirksamsten – und notwendigsten – Hebel für echten Fortschritt. Diese Emissionen sind tief in komplexen globalen Lieferketten verankert, die auf petrochemische Derivate, landwirtschaftliche Rohstoffe und andere CO₂-intensive Inputs angewiesen sind.
Führende Unternehmen überdenken daher ihre Arbeitsweise – und das Beschaffungswesen entwickelt sich zu einem zentralen Hebel für Fortschritt. Indem Emissionen in Beschaffungsentscheidungen integriert werden – von Lösungsmitteln bis hin zu Lieferantenverträgen – konzentrieren sie sich auf die Schnittstellen von CO₂-Intensität und Kosten. Einige Unternehmen gestalten ihre Lieferketten neu, indem sie sich auf die wichtigsten Kategorien konzentrieren – wie fossile Rohstoffe, Katalysatoren und Dienstleistungen Dritter – um Emissionen zu senken, Kosten zu reduzieren, Preisvolatilität zu steuern und sich den Zugang zu essenziellen Materialien in einem zunehmend angespannten Markt zu sichern.
Die Einbindung von CO₂-Daten in Beschaffungsentscheidungen verschafft Unternehmen mehr Transparenz über ihre Scope-3-Emissionen und ihre Risiken im Zusammenhang mit verschärften CO₂-Bepreisungssystemen – etwa dem EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) und dem kommenden CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM). So können sie frühzeitig Maßnahmen ergreifen – etwa zur Reduktion von Emissionen in der Lieferkette – und steigenden Compliance-Kosten infolge wachsender CO₂-Preise vorbeugen.
Um diesen Wandel zu unterstützen, haben sich Quantis und Inverto zusammengeschlossen, um Chemieunternehmen dabei zu helfen, einen strategischeren Ansatz bei der Beschaffung zu verfolgen. Durch die Kombination fundierter Beschaffungsexpertise mit wissenschaftlich fundierter CO₂-Analyse sollen Unternehmen dabei unterstützt werden, Entscheidungen zu treffen, die Emissionen senken und die Resilienz stärken – ohne Kompromisse bei Kosten oder Wettbewerbsfähigkeit.
Skalierung der Auswirkungen im gesamten Scope 3
Es gibt nur wenige Sektoren, deren Scope-3-Fußabdruck so komplex – oder so chancenreich – ist wie die Chemie.
Die effektivsten Unternehmen konzentrieren ihre Bemühungen auf die Bereiche, in denen sie die größte Wirkung erzielen können: Sie messen den Kohlenstoff-Fußabdruck von Rohstoffen und Produktionsprozessen, um emissionsintensive Einsatzstoffe wie Ethylen oder Ammoniak zu identifizieren. Sie stellen auch auf erneuerbare Rohstoffe um – weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Ressourcen wie Biomasse, Algen und landwirtschaftlichen Abfällen, die zunehmend für den großtechnischen Einsatz bereit sind.
Diese Strategien liefern schnelle, messbare Ergebnisse – sie reduzieren die Emissionen und verbessern gleichzeitig die finanzielle Leistung.
Um diesen Schwung aufrechtzuerhalten und die Wirkung zu skalieren, verankern Unternehmen Nachhaltigkeit in ihren Beschaffungsrichtlinien und den Bewertungskriterien für Lieferanten. Die Unternehmen mit den größten Fortschritten stimmen ihre Beschaffung auf wirkungsstarke Dekarbonisierungshebel wie Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und erneuerbare Energien ab. Viele dieser Hebel sind ausgereift, kosteneffizient und umsetzungsbereit – also schnell realisierbare Maßnahmen, um Emissionen zu senken und gleichzeitig finanzielle Vorteile zu erzielen.
Vom Kohlenstoff zur Natur: Was für die Chemie auf dem Spiel steht
Viele der Emissionstreiber in der Lieferkette – wie Landnutzung, Wasserverbrauch und Rohstoffbeschaffung – bergen zugleich erhebliche naturbezogene Risiken. Die Betrachtung dieser Themen unter dem Aspekt der Emissionen bringt häufig zusätzliche Vorteile für Biodiversität und die Resilienz von Ökosystemen – und verbindet so Klima- und Naturschutz in einer gemeinsamen Maßnahme.
Nehmen wir Wasser als Beispiel – ein wichtiger Betriebsfaktor für die chemische Industrie. Laut CDC Biodiversité hängen rund 70 % der ökologischen Abhängigkeiten des Sektors mit der Nutzung von Oberflächen- und Grundwasser zusammen – insbesondere bei katalytischem Cracken und Destillation. In Regionen mit klimabedingtem Wasserstress bieten naturbasierte Lösungen wie künstlich angelegte Feuchtgebiete oder regenerative Beschaffungspraktiken nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch Versorgungssicherheit und Kosteneinsparungen.
Integriert in Beschaffungsstrategien werden diese Ansätze Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets – von der Überarbeitung von Produktspezifikationen über den Umstieg auf biobasierte Rohstoffe bis hin zur Zusammenarbeit mit emissionsärmeren Lieferanten. Diese Maßnahmen senken nicht nur Emissionen, sondern stärken auch die Resilienz gegenüber naturbezogenen Risiken, verbessern die regulatorische Konformität und festigen die gesellschaftliche Akzeptanz des Geschäftsbetriebs.
Der Weg der chemischen Industrie in die Zukunft
Der Weg zur Dekarbonisierung im Chemiesektor ist komplex – aber er erweist sich als Katalysator für stärkere, widerstandsfähigere Unternehmen.
Unternehmen, die Emissionen als strategischen KPI – und nicht nur als Maßstab für die Einhaltung von Vorschriften – betrachten, finden neue Wege, um Risiken zu verringern und die Beziehungen zu ihren Lieferanten zu stärken. Damit reduzieren sie nicht nur das Risiko , sondern ermöglichen auch flexiblere Abläufe und tiefere Beziehungen zu den Lieferanten, die das Vertrauen für künftige Innovationen und Risikoteilung schaffen.
Hinzu kommt, dass viele der gleichen Druckpunkte, die die Kohlenstoffauswirkungen beeinflussen, auch die Exposition gegenüber naturbezogenen Risiken bestimmen. Werden sie gemeinsam angegangen, stärkt dies sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die Widerstandsfähigkeit der Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen.
Bei der Dekarbonisierung geht es nicht darum, ein Nachhaltigkeitskästchen anzukreuzen – es geht darum, die Art und Weise zu überdenken, wie Unternehmen einkaufen, Lieferantenbeziehungen aufbauen und ihre Produktauswahl an zukunftsfähigen Leistungskennzahlen ausrichten. Nachhaltigkeit ist nicht länger eine Nebeninitiative. Sie wird zur Grundlage dafür, wie die chemische Industrie in einer vom Klimawandel geprägten Welt arbeiten, konkurrieren und wachsen wird. Die Unternehmen, die sich jetzt auf den Weg machen, erfüllen nicht nur die Erwartungen – sie definieren die Zukunft des Sektors.
Erfahre, wie Quantis Chemieunternehmen dabei unterstützt, Emissionen zu senken, Beschaffung neu zu denken und dem Wandel von Markt- und Regulierungsanforderungen einen Schritt voraus zu sein.