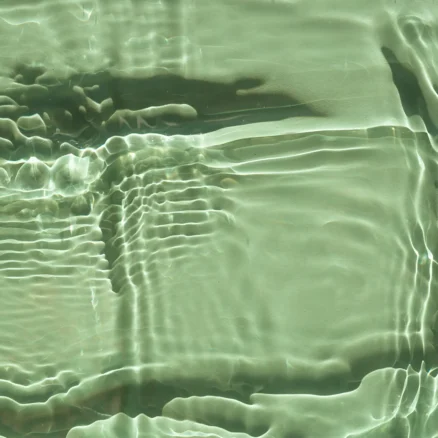In Kürze:
- Das Rennen um die Erreichung der Klimaziele bis 2030 ist in vollem Gange – doch die meisten Unternehmen hinken bei der Umsetzung ihrer Dekarbonisierungsziele hinterher.
- Chief Sustainability Officers (CSOs) stehen unter wachsendem Druck, Ergebnisse zu liefern – trotz knapper Budgets, sich wandelnder Vorschriften und eines angespannten ESG-Umfelds.
- Um echten Fortschritt zu erzielen, müssen die richtigen Hebel zur Dekarbonisierung identifiziert und mit dem geschäftlichen Mehrwert in Einklang gebracht werden.
- Drei typische Szenarien bremsen Klimaschutzmaßnahmen aus – jedes mit eigenen Hürden, aber auch ungenutzten Potenzialen für Unternehmen und Klima.
- Ein wertorientierter Ansatz für die Klimastrategie kann Maßnahmen fokussieren, die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens stärken und die Klimaziele für 2030 wieder in greifbare Nähe rücken.
Mit dem fünfjährigen Countdown bis zu den Klimazielen 2030 befinden wir uns in einer entscheidenden Phase des Nachhaltigkeitsrennens. In den letzten zehn Jahren konnte die Unternehmensnachhaltigkeit zahlreiche Erfolge verzeichnen, die gefeiert werden dürfen: Viele Großunternehmen erfassen CO₂-Emissionen inzwischen als zentrale Kennzahl, haben ambitionierte wissenschaftsbasierte Ziele formuliert und können echte Fortschritte bei der Reduzierung von Scope-1- und Scope-2-Emissionen vorweisen.
Für CSOs ist der Weg nach vorn jedoch herausfordernder denn je. Der Fokus hat sich auf Scope-3-Emissionen verlagert, die ohnehin deutlich schwerer zu reduzieren sind – und das unter zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen. Das sich wandelnde makroökonomische Umfeld erhöht den Druck auf Nachhaltigkeitsbudgets, da Unternehmen mit zunehmenden Gegenwinden zu kämpfen haben – darunter globale Marktunsicherheit, Störungen in den Lieferketten, neue regulatorische Anforderungen und steigende Pflichten zur Berichterstattung. Gleichzeitig wächst die Gegenbewegung gegen ESG weiter.
Diese zunehmend komplexe Landschaft stellt eine erhebliche Hürde für CSOs und vorausschauende Unternehmensführungen dar. Sie müssen – und zwar dringend – zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein moralisches, sondern auch ein strategisches Gebot ist, bei dem das Kerngeschäft auf dem Spiel steht. Ein aktueller Bericht von Quantis und BCG unterstreicht diese Dringlichkeit: Klimabedingte Auswirkungen könnten Verluste von bis zu 25 % des jährlichen EBITDA verursachen. Kurz gesagt: Während wir beim Thema Dekarbonisierung insgesamt zu langsam vorankommen, werden die unmittelbaren Folgen des Klimawandels zunehmend unausweichlich.
CSOs müssen – und zwar dringend – zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein moralisches, sondern ein strategisches Gebot ist, bei dem das Kerngeschäft auf dem Spiel steht.
CSOs befinden sich derzeit in einem Paradox: Sie sehen sich gleichzeitig zunehmendem Gegenwind und wachsendem Druck ausgesetzt, konkrete Ergebnisse zu liefern. Laut einer aktuellen Umfrage von Economist Impact erwarten 90 % der CSOs weiterhin, dass Investoren ihre Nachhaltigkeitsleistung genau prüfen – trotz politischer Gegenströmungen. Und für die meisten steigen die Budgets nicht. CSOs haben schon heute eine der anspruchsvollsten und ambitioniertesten Rollen im Unternehmen – und nun wird von ihnen erwartet, mit weniger Mitteln noch mehr zu leisten.
Wie also können Nachhaltigkeitsverantwortliche diese Hürden überwinden? Um ein überzeugendes Business Case für die Klimastrategie zu schaffen, kann es notwendig sein, diese neu zu bewerten. Ob Klimaziele erreicht und Resilienz dauerhaft im Unternehmen verankert werden können, hängt davon ab, ob Dekarbonisierungsstrategien auf die richtigen Prioritäten ausgerichtet sind und echten geschäftlichen Mehrwert schaffen.
Um Klimafortschritte zu erzielen, musst du zuerst wissen, wo du stehst
Glücklicherweise bietet dieser kritische Wendepunkt auch eine Chance: Jetzt ist der ideale Moment für CSOs, um zu prüfen, wie ihre Klimastrategien zu den übergeordneten Unternehmenszielen passen und welchen Beitrag sie zur Wertschöpfung leisten können. Diese Reflexion ermöglicht es Nachhaltigkeitsteams, ihre Klimastrategien neu auszurichten – abgestimmt auf die unternehmerischen und marktseitigen Realitäten – und sich auf Maßnahmen zu konzentrieren, die wirklich einen Unterschied im Hinblick auf die 2030-Ziele machen.
Aus unserer Arbeit mit Unternehmen verschiedenster Branchen wissen wir bei Quantis, dass die meisten Firmen grob in eines von drei Szenarien fallen – jedes davon bringt eigene Hürden für den Fortschritt im Klimaschutz mit sich.
Szenario #1: Mit voller Kraft an klimawirksamen, aber schwachen Hebeln ziehen
Viele Unternehmen zeigen eine hohe Umsetzungsrate ihrer Klimafahrpläne – insbesondere bei Scope-1- und Scope-2-Emissionen. Der Fokus liegt jedoch häufig zu sehr auf kleineren, schrittweisen Maßnahmen, während Aktivitäten übersehen werden, die sowohl für die Dekarbonisierung als auch für die Geschäftsentwicklung wesentlich mehr Potenzial bieten würden. Das Gefühl von Fortschritt kann dabei trügen – es beschränkt sich oft auf Quick Wins wie die Elektrifizierung von Lieferflotten oder Solarpanels auf Mitarbeiterparkplätzen. Auch wenn jeder Fortschritt zählt, bleiben zentrale Emissionsquellen – meist in Produkten und Lieferketten (Scope 3) – weitgehend unberührt. Diese Bereiche erfordern tiefgreifendere, transformative Veränderungen – und genau hier geraten die Klimaziele zunehmend außer Reichweite. Wenn die Dekarbonisierungsreise bis 2030 eine Autoreise wäre, macht dieses Szenario viele Zwischenstopps – verpasst dabei aber die entscheidende Abzweigung zum eigentlichen Ziel.
Die Speisekarte auffrischen: Eine verpasste Chance für mehr Wirkung
Fast-Food-Unternehmen A steht beispielhaft für Szenario #v1 – wie die folgenden Beispiele zeigen. Das Unternehmen versucht, durch Zusammenarbeit mit Lieferanten die Zutaten zu dekarbonisieren – allerdings auf Kosten grundlegender Änderungen am Produktportfolio. Es ist erfolgreich bei Maßnahmen auf landwirtschaftlicher Ebene, wie z. B. der Sicherstellung entwaldungsfreier Futtermittel oder Investitionen in die Genetik von Viehherden. Diese Hebel sind zwar wertvoll, aber auch kostenintensiv – und sie bringen das Unternehmen nur begrenzt bei der Emissionsreduktion voran.
Ein wirkungsvollerer – und oft kostengünstigerer – Ansatz wäre, die Speisekarte selbst anzupassen. Die Integration kohlenstoffärmerer, aber dennoch attraktiver Produkte mit der richtigen Vermarktung – etwa durch andere Proteinquellen oder pflanzliche Alternativen – könnte schneller und nachhaltiger Wirkung zeigen. (Ein Kunde kommt für einen Rindfleischburger – entscheidet sich aber dank attraktiver Präsentation für die Pulled-Pork-Variante.) Neben der Kostenersparnis und dem hohen Dekarbonisierungspotenzial würde das Unternehmen auch Resilienz gegenüber steigenden Rindfleischpreisen aufbauen – die voraussichtlich durch regulatorische Vorgaben wie die EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Produkten (EUDR) und zunehmende klimabedingte Risiken weiter steigen werden.
Die wirkungsvollsten Hebel zur Dekarbonisierung und Klimaanpassung sind häufig dieselben. Wenn Unternehmen ihre Klimastrategien unter dem Aspekt des geschäftlichen Nutzens betrachten – etwa durch den Fokus auf Resilienz –, können sie sich auf wirkungsstarke Maßnahmen konzentrieren, die greifbare Ergebnisse liefern. Eine aktuelle Analyse des Weltwirtschaftsforums und von BCG zeigt: Unternehmen, die derzeit in Anpassung, Dekarbonisierung und Resilienz investieren, vermeiden bis zu 19 US-Dollar an Verlusten für jeden eingesetzten Dollar.
Szenario #2: Wirkung starke Klimaschutzhebel, aber zu wenig Kraft, sie zu betätigen
Am anderen Ende des Spektrums stehen Unternehmen, die zwar wirkungsvolle Dekarbonisierungsmaßnahmen identifiziert haben, aber intern nicht über die nötige Durchschlagskraft verfügen, um diese breit umzusetzen. Diese Unternehmen wissen, was zu tun ist und an welchen Hebeln sie ansetzen müssen – und dennoch bleiben ihre Klimapläne häufig isoliert in der Nachhaltigkeitsabteilung verankert. Es fehlt ein robuster, strukturierter Plan, um die Maßnahmen im gesamten Unternehmen zu verankern.
Auf CSO-Ebene mögen die Lösungen klar sein, doch die eigentliche Herausforderung besteht darin, funktionsübergreifendes Engagement zu aktivieren – vom Einkauf über das Marketing bis hin zu Finanzen und Betrieb. Ohne klares Verständnis ihrer Rolle bei der Dekarbonisierung sowie abgestimmte KPIs und Anreize wird die Erreichung von Klimazielen zur unlösbaren Aufgabe. Auf der Klimareise dieser Unternehmen ist das Ziel zwar klar und die Route stimmt – aber die Mitreisenden helfen dem Fahrer nicht bei der Navigation. Die Reise zieht sich – und man kommt vielleicht irgendwann an, aber es dauert deutlich länger als nötig.
Voll ausgestattet, aber ohne Ziel: Die Klimaherausforderung einer Luxusmodemarke
Nehmen wir zum Beispiel Luxusmodemarke B. Die Nachhaltigkeitsabteilung gibt sich große Mühe, interne Leitlinien zu entwickeln, welche Rohstoffe aus Klimasicht priorisiert werden sollten, oder arbeitet gemeinsam mit Produktmarketing und Design an innovativen, kohlenstoffarmen Kapselkollektionen. Doch ohne eine unternehmensweite Abstimmung verwässern diese Bemühungen. Design und Einkauf machen – mangels klarer Anreize – einfach das, was von ihnen erwartet wird: kreative Kleidung entwerfen und Materialien nach Preis und Qualität einkaufen.
Das ist eine verpasste Chance, sowohl geschäftlich als auch fürs Klima Wirkung zu erzielen. Wenn die Klimastrategie stattdessen als Chance für einen First-Mover-Vorteil verstanden wird – sei es durch den Eintritt in neue Märkte, den Aufbau stabiler Beziehungen zu Lieferanten knapper Rohstoffe oder durch die Positionierung als Brancheninnovator – lassen sich Führungskräfte leichter einbinden und ihre Teams gezielt motivieren. Auf dieser Basis wird auch die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zur Optimierung der Kosten der Klimatransformation deutlich einfacher.
Wirklicher Fortschritt erfordert mehr als ambitionierte Zielsetzungen – er verlangt danach, diese bereichsübergreifend zu verankern, KPIs abzustimmen und Nachhaltigkeit in die Governance-Strukturen zu integrieren. Ein oft übersehener, aber entscheidender Schritt ist, für jede Abteilung einen überzeugenden, nutzenbasierten Business Case zu formulieren – also die Frage zu beantworten: „Was habe ich davon?“ Für den Einkauf könnten das etwa eine gesicherte Lieferkette, engere Beziehungen zu Lieferanten und höhere Qualität sein. Für den Vertrieb könnte sich die Möglichkeit ergeben, als bevorzugter Lieferant für B2B2C-Unternehmen mit Klimazielen positioniert zu werden. Die Liste lässt sich fortsetzen.
Szenario #3: Starke Klimaschutzhebel und motivierte Akteure, aber zu wenig Durchsetzungskraft
Wie im vorherigen Szenario wissen diese Unternehmen, was zu tun ist – und ziehen möglicherweise bereits an den richtigen Hebeln. Oft gibt es eine grundsätzliche Unterstützung durch die Führungsebene und andere Abteilungen. Doch ohne ausreichende personelle Kapazitäten, spezielles Fachwissen oder finanzielle Mittel scheitert die Umsetzung. Allzu häufig ist der Business Case für Nachhaltigkeit unvollständig – insbesondere wenn es um die Finanzierung geht. Woher soll die Anfangsinvestition zur Dekarbonisierung der Lieferkette kommen? Wie gewinnen wir die richtigen Talente, um unsere Vorhaben Realität werden zu lassen? Ohne eine klare finanzielle Grundlage bleiben selbst die bestdurchdachten Pläne stecken. In diesem Szenario ist die Route gut geplant und alle Mitfahrenden sind an Bord – aber das E-Auto hat nicht genug Ladung, um das Ziel zu erreichen.
Die fehlende Formel: Ressourcen durch strategische Ausrichtung freisetzen
Parfümunternehmen C erkennt, dass einer seiner wirkungsvollsten Dekarbonisierungshebel in den Glasflaschen liegt. Um Emissionen zu senken, müssen die Lieferanten recyceltes Glas verwenden und ihre Herstellungsprozesse dekarbonisieren – oder elektrifizieren. Doch diese Umstellungen sind mit Kosten verbunden.
Für Glashersteller – häufig kleine bis mittelständische Unternehmen – sind die nötigen Investitionsausgaben (CAPEX) schwer zu stemmen. Um das abzufedern, bieten sie möglicherweise „Low-Carbon-Glas“ zu einem Aufpreis an oder verhandeln langfristige Verträge und Abnahmevereinbarungen mit Unternehmenskunden, um stabile Nachfrage zu sichern. In diesem Fall geht es bei der Dekarbonisierung nicht nur um Emissionen – sondern um die Neuausrichtung des Geschäftsmodells. Für den Glaslieferanten wird die Investition in Dekarbonisierung zum Weg hin zu langfristigem Mehrwert, Stabilität und engeren Kundenbeziehungen.
Diesen Business Case muss Parfümunternehmen C seinen Lieferanten vermitteln – idealerweise über gezielte Engagement-Programme und oft wirkungsvoller in Zusammenarbeit mit Branchenpartnern.
Doch wie steht es um die Kosten, die Parfümunternehmen C selbst entstehen werden? Hier muss das Gespräch über Anfangsinvestitionen neu aufgesetzt werden: Es geht nicht nur darum, dass der Klimaplan höhere Kosten verursacht – sondern darum, dass er vielfachen Nutzen bringt. Investitionen in eine nachhaltige Lieferkette tragen zugleich zu ihrer Stabilisierung bei. Die langfristige Sicherung der Flaschenversorgung – die künftig wahrscheinlich CO₂-Abgaben unterliegt – ist nicht nur ein Vorteil für Betrieb und Einkauf, sondern stärkt auch die gesamte unternehmerische Resilienz.
Ein entscheidender Hebel zur Lösung von Ressourcenengpässen – insbesondere bei knappen Budgets – besteht darin, Klimaziele mit den Zielen anderer Abteilungen zu verknüpfen. Wenn Nachhaltigkeitsmaßnahmen mit übergeordneten Unternehmenszielen verbunden werden, können die notwendigen Ressourcen erschlossen und Investitionen über Abteilungsgrenzen hinweg effizienter gesteuert werden.

Rücke deine Klimastrategie mit einem wertorientierten Blick wieder ins Zentrum
Auch wenn das Rennen um die Klimaziele 2030 an Tempo gewinnt, kann ein kurzer Schritt zurück – um die Strategien aus einer neuen Perspektive zu betrachten – der schnellste Weg nach vorn sein. Um relevant und wirksam zu bleiben, müssen Klimastrategien ihren geschäftlichen Mehrwert über die reine Dekarbonisierung hinaus klar aufzeigen.
Die wirkungsvollsten Dekarbonisierungsmaßnahmen ermöglichen es Unternehmen außerdem:
- Der steigenden Nachfrage nach Nachhaltigkeit von B2C-Kunden und Verbrauchern gerecht werden, bevorzugter Lieferant werden und sich frühzeitig den Zugang zu künftig knappen Ressourcen sichern.
- Neue Geschäftsbereiche erschließen und durch innovative, nachhaltige Geschäftsmodelle Wert schaffen.
- Die Resilienz der Lieferkette stärken, zur Risikominderung beitragen und künftige Kosten vermeiden.
- Den First-Mover-Vorteil nutzen, um sich öffentliche und private Finanzierungen zu sichern und die Kosten der Klimatransformation zu senken.
- Entlang der Lieferkette Partnerschaften eingehen, um sich den Zugang zu künftig knappen Rohstoffen zu sichern.
- Die Reputation schützen und stärken, um das Vertrauen der Verbraucher:innen und die Rentabilität zu sichern.
Wenn du deine Klimastrategie aus einer wertorientierten Perspektive neu denkst, wird Nachhaltigkeit zum festen Bestandteil der Unternehmensstrategie – verankert in den zentralen Prioritäten. Wird Klimaschutz unternehmensweit verankert, ist er nicht nur leichter umzusetzen, sondern auch wirkungsvoller – für den Planeten und für das Geschäft.

Wie Quantis Unternehmen auf dem Weg zu den Klimazielen 2030 unterstützt
Auch in einem herausfordernden Umfeld ist Fortschritt möglich. Dafür muss nicht bei null begonnen werden – es braucht nur einen veränderten Fokus. Quantis bietet einen maßgeschneiderten Rahmen, mit dem Unternehmen ihre Klimastrategie neu ausrichten – auf wirkungsvolle Maßnahmen mit maximalem Mehrwert. Entdecke unsere Lösungen zur Emissionsminderung und kontaktiere uns, um zu erfahren, wie wir dein Team bei der Erreichung der Klimaziele 2030 unterstützen können.